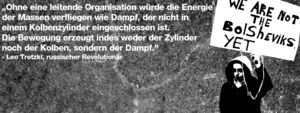Ehrenamt: Kapitalismus profitiert von Menschlichkeit
Sa 16.01.2016
Menschen haben keinen Job, Flüchtlinge kein Essen und Geld ist keines da. Wie soll das bewältigt werden? Glücklicherweise gibt uns „unser“ Staat“ flink eine Antwort: durch das Ehrenamt, die Freiwilligenarbeit. Denn diese hat im „Abendland“ Tradition. „Der individuelle Beitrag zum allgemeinen Wohl“ gehörte schon in der Antike zum guten Ton. Alleine die „kirchliche Arbeit“ für das „Seelenwohl“ hat in vergangenen Jahrhunderten Unzählige zu freiwilliger Arbeit animiert (bzw. verpflichtet). Alle Religionen stellen so ein Bindeglied her: Zwischen der Menschlichkeit des Individuums, das andere unterstützen will, und den Begehrlichkeiten der Klassengesellschaft, die dafür sorgt, dass es Armut und Elend gibt. An diesem Spagat hat auch die aufgeklärte bürgerliche Gesellschaft nichts geändert. Zwar konnte die ArbeiterInnenbewegung v.a. in den Industriestaaten öffentliche Sozialeinrichtungen erkämpfen, doch sind diese nicht ausreichend und werden weggekürzt. Daher ging der Neoliberalismus seit den 1980er Jahren auch einher mit einer ideologischen Offensive, in der ehrenamtliche Tätigkeit gelobt und gefördert wurde. Hilft sie doch die Löcher stopfen, die der Sozialabbau reißt.
Heute engagieren sich laut CEV (European Volunteer Centre) 3 von 10 EuropäerInnen ehrenamtlich. „Nichtregierungsorganisationen“ sprießen, die Landeshauptstädte bieten über ihre Web-Auftritt Ehrenamtsbörsen an und die großen Sozialträger und –institutionen können sich meist nur durch freiwilliges Engagement über Wasser halten. Statistiken der BMASK (2013) zählen 14,7 Millionen Arbeitsstunden, welche in Österreich jährlich freiwillig geleistet werden. Diese Arbeitsleistung entspricht 230.000 Vollzeitstellen. Wären es bezahlte Jobs, könnte die Arbeitslosigkeit um mehr als die Hälfte reduziert werden. Und es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der unglaublichen Solidarisierung mit Flüchtlingen diese Zahl rapide angestiegen ist.
Die kostenlose (oft von Frauen geleistete) Arbeit spart dem Kapital Milliarden. Die brutalen Folgen des Neoliberalismus werden so kaschiert. Und die Hilfsbereitschaft wird auch ausgenützt, um Löhne zu drücken und Arbeitsschutzbestimmungen aufzuweichen. Anstatt angesichts der vielen Fahrten mit Flüchtlingen ausreichend Personal einzustellen setzte die Regierung z.B. einfach die Regelung für die Ruhezeiten bei den PostbusfahrerInnen außer Kraft. Der Umgang der Herrschenden mit dieser Arbeit ist mehr als zynisch. Denn „entlohnt“ werden jene, die Gutes tun, meist nur durch einen feuchten Händedruck oder ein symbolisches Dankeschön (ein medienwirksames Danke-Fest z.B.).
Es ist gut, wenn der ÖGB die Rechte von Ehrenamtlichen verteidigt (z.B. wenn die Neos Menschen unbezahlt beschäftigen wollen oder das Team Stronach Geld von Ehrenamtlichen verlangt). Doch das reicht bei weitem nicht. Es wäre die Aufgabe der Gewerkschaft, nicht nur Resolutionen zu verabschieden, sondern gut bezahlte Vollzeitjobs zu erkämpfen. Es darf hier keine Spaltung in Ehrenamtliche und „Profis“ zugelassen werden. Wenn Freiwilligenarbeit als Grund für Lohnsenkungen verwendet wird, muss der ÖGB dies mit einer Kampagne für eine saftige Lohnerhöhung und Jobs für die Ehrenamtlichen (und die Hauptamtlichen) kontern. Gerade vor dem Hintergrund der steigenden Arbeitslosigkeit wäre dies eine Maßnahme, welche mehr bringt als jedes Regierungs-„konzept“ der vergangenen Jahrzehnte.
Die Hilfsbereitschaft der unzähligen HelferInnen und ehrenamtlich arbeitenden Menschen ist großartig und zeigt, dass es nicht möglich ist, dem Menschen seine soziale Veranlagung auszutreiben. Auch wenn wir hin zu Egoismus und Ellenbogengesellschaft erzogen werden. Das zeigt auch, dass all das Gerede, dass der Sozialismus am Egoismus der Menschen scheitern würde, Blödsinn ist. Diese Arbeit ist – wenn wirklich freiwillig – selbstbestimmter und weniger entfremdet als die zum Überleben nötige „Lohnarbeit“. Neben diesem Element der Selbstverwirklichung durch sinnstiftende Arbeit gibt es auch noch die Notwendigkeit dazu. In der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung ist in die unterschiedlichsten politischen Aktivitäten freiwillig Arbeitszeit investiert worden. Zehntausende BetriebsrätInnen, GewerkschafterInnen und politische AktivistInnen arbeiten ehrenamtlich. Sie sind es auch, die immer wieder darauf achten müssen, dem Helfen eine politische Dimension zu geben. Zu verhindern, dass sich HelferInnen aufreiben um die Löcher zu stopfen, die die öffentliche Hand lässt und das Helfen mit dem politischen Kampf für mehr bezahlte Ressourcen und auch mit dem Kampf für eine andere, eine bessere Gesellschaft zu verbinden.
In einer sozialistischen Gesellschaft, wo Arbeit nicht mehr Zwang und Ausbeutung ist, sondern kreativ, interessant und sinnvoll ist und wo die Arbeitszeit durch den technischen Fortschritt auf ein Minimum reduziert wird, haben wir alle genug Zeit und Möglichkeit, uns „ehrenamtlich“ einzubringen. Nicht pervertiert und missbraucht wie so viele Dinge in der kapitalistischen Normalität.