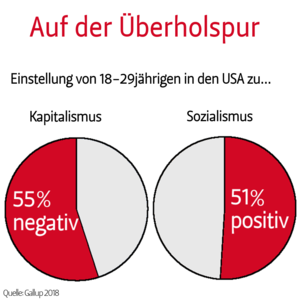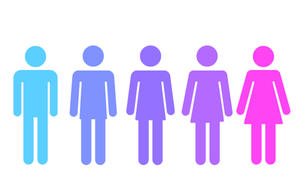„Meine Träume kennen keine Grenzen, bis eine Kugel ihnen ein Ende setzt“, hatte der lateinamerikanische Revolutionär Ernesto Che Guevara zu seinen Lebzeiten einem Journalisten entgegnet, der von ihm wissen wolle, wie weit er noch gehen würde. Als Partisan hatte er in drei Revolutionen und Revolutionsversuchen mit der Waffe in der Hand gegen Unterdrückung gekämpft. Am 9. Oktober 1967 wurde er, nach seiner Gefangennahme durch Regierungstruppen, ermordet. Che Guevara glaubte nicht daran, dass man ein unterdrückerisches Regime vollkommen gewaltfrei würde bezwingen können.
Nicht einmal ein halbes Jahr nach jenem Mord ereignete sich ein weiterer: Martin Luther King jr., einer der entscheidenden Führer der Bewegung gegen die Unterdrückung der Afroamerikaner*innen, wurde in Memphis, in Tennessee am Vorabend einer geplanten Großdemonstration von Streikenden vor seinem Hotelzimmer mit einem Kopfschuss getötet. Und auch King hatte eine Traum gehabt, wie er im glutheißen August 1963 vor nicht weniger als einer Viertelmillion Demonstrant*innen in der US-amerikanischen Hauptstadt ausrief: „Ich habe einen Traum, dass man meine drei kleinen Kinder nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird.“ So fern wie diese Sätze damals – im Angesicht rassistischer Gesetze und militanter rechter Gruppen – klangen, so fern scheinen sie mitunter heute, im Angesicht des weltweiten Erstarkens rechter und rassistischer Kräfte.
Rassistische Unterdrückung in den USA
Nach dem Ende des US-Bürger*innenkrieges, in dem der industrialisierte Norden über den Süden triumphierte, in dem schwarze Sklav*innen auf Plantagen den Reichtum erwirtschaftet hatten, glaubten viele Afroamerikaner*innen an ihre Gleichberechtigung. Und zunächst sah sogar Vieles danach aus: Ausgerechnet in dem ehemaligen Sklavenhatlerstaat South Carolina war die Mehrheit der Parlamentsabgeordneten schwarz. Doch das weiße Establishment war nicht bereit diese Entwicklung hinzunehmen. Der Ku Klux Klan, eine schlagkräftige Truppe weißer Rassisten überfiel und ermordete zahlreiche Schwarze. Weiße Unternehmer, auf der Suche nach billigen Arbeitskräften, erwirkten die Einführung von Gesetzen in allen Südstaaten, die nur denen das Wahlrecht zubilligten, deren Großväter schon hatten wählen dürfen. Diese Großvätergesetze nahmen den Schwarzen das Wahlrecht.
Erschreckende Arbeits- und Lebensbedingungen, besonders in den Südstaaten fesselten die weit überwiegende Mehrzahl der afroamerikanischen Familien in bitterer Armut. Ständige Überfälle und Morde waren an der Tagesordnung. Bestraft wurden selten die Täter*innen, viel häufiger jedoch die Opfer, wenn sie sich zur Wehr gesetzt hatten. Polizei und Gerichte, der Staatsapparat, war von Rassist*innen durchdrungen.
In allen Südstaaten wurde die sogenannte „Rassentrennung“, die Trennung der Bevölkerung nach Hautfarbe, Realität. Der Grundsatz „seperate but equal“ war schon deshalb bloße Kosmetik, weil die Schulen für Schwarze erschreckend aussahen. Schulen, Bibliotheken, Busse, Kinos, selbst Toiletten durften Schwarze und Weiße nicht gemeinsam benutzen.
Für viele Schwarzen waren die Kirchen, besonders die Baptistengemeinden, die einzigen Orte, an denen sie einigermaßen sicher waren, sich austauschen, diskutieren und Trost finden konnten.
Initialzündung Montgomery
Es war das Mantra der Marxistin Rosa Luxemburg: „Aussprechen was ist, bleibt eine revolutionäre Tat“, wiederholte sie immer wieder. Den Vorhang der unhinterfragten Normalität zu lüften und der Öffentlichkeit die schonungslose Wahrheit über die kapitalistische Realität zu zeigen, ersetzt weder den Aufstand, noch ließ es ihn zum Automatismus werden. Aber es bildete schon immer die Voraussetzung zum Handeln.
Zu Beginn des Dezembers 1955 war es eine afroamerikanische Näherin, Rosa Parks, die diesen Vorhang lüftete. Im Grunde war Rosa Parks einfach sitzen geblieben. Nichts Großartiges – so könnte man meinen. Aber zu einer Zeit, in der es schwarzen Fahrgästen in den öffentlichen Bussen Montgomerys untersagt war vorn im Bus zu sitzen und ihnen selbst das Sitzen auf den hinteren Plätzen nur erlaubt war, solange weiße Fahrgäste diese nicht verlangten, war Parks Tat an Mut schwer zu überbieten.
Es kam wie es im Alabama der 50er Jahre kommen musste: Parks wurde verhaftet, weil sie als Näherin nach einem Arbeitstag in ihrer Fabrik nicht mehr stehen wollte! Man legte die Kaution auf 100 US-Dollar fest. Für eine Arbeiterin in diesen Jahren unbezahlbar.
Ein schwarzer Gewerkschafter – E.D. Nixon – nahm sich ihres Falles an: Er besorgte eine Anwalt, stellte Kaution und benachrichtigte eine schwarze Frauenorganisation über Rosa Parks Schicksal. Dann kontaktierte er Martin Luther King. Der junge Familienvater hatte Zweifel. Dennoch öffnete er seine Kirche für eine Beratung all derer, die in dem Fall aktiv werden wollten.
Für den Tag der Gerichtsverhandlung, den 5. Dezember, forderte man die afroamerikanische Bevölkerung Montgomerys auf das Mitfahren in den Bussen der Stadt zu verweigern. Martin predigte dies von der Kanzel seiner Kirche am Sonntagmorgen und am nächsten Tag wurde er Zeuge eines kaum zu erwartenden Erfolges. Er selbst hatte mit einer Verweigerung von bestenfalls 50 Prozent gerechnet. Doch es fuhr fast kein Schwarzer in Montgomery mit dem Bus.
Die Zeit war reif gewesen und Rosa Parks mutige Tat hatte das Fanal gesetzt. Trotz aller Anschläge und Angriffe durch Rassist*innen blieb der Boykott aufrecht. Und die Klage vor dem Obersten Gerichtshof in Alabama gegen die Segregation von Schwarz und Weiß war ein voller Erfolg. Allen Rufen von der Unabhängigkeit der Gerichte zum Trotz, wäre der Sieg vor Gericht ohne die Massenbewegung in Montgomery unvorstellbar gewesen. Und selbst dann setzte das Gericht auf Verzögerungen und stellte den Gerichtsbescheid nicht an die Stadt Montgomery zu. Der Boykott fand sein Ende erst mit der Annahme des Beschlusses durch die Stadt.
Kompromisslose Gewaltfreiheit
Anders als der eingangs zitierte Che Guevara – der in Lateinamerika und Afrika bewaffnet gegen Ausbeutung und Unterdrückung kämpfte, weil er an eine tiefgreifende Reformierbarkeit des kapitalistischen Systems nicht glaubte – war Martin Luther King lange Zeit der festen Überzeugung, man könne, ja man müsse die Spielräume des Systems zur Verbesserung des Lebens für alle ausnutzen. „Einer der Glanzpunkte der Demokratie ist das Recht für das Recht kämpfen zu dürfen“, hatte er seinen Anhänger*innen zu Beginn des Busboykotts in Montgomery zugerufen. Die Schwarzen in den USA waren für ihn vor allem eines: Bürgerinnen und Bürger eben jenes Landes. Sie sollten nur nicht mehr Bürger*innen zweiter Klasse sein! Also musste es darum gehen das Land in eine Land für alle dort lebenden Menschen zu verwandeln.
Daraus leitete King auch einen absoluten Verzicht auf Gewalt ab. Wie sein großes Vorbild Gandhi, der die britische Kolonialherrschaft über Indien mit seinem gewaltlosen Widerstand ins Wanken brachte, wollte auch King die Unterdrückung in den Vereinigten Staaten durch Aktionen, die ganz bewusst auf Gewalt verzichteten beenden.
Selbst, als während des Busboykotts ein Anschlag auf sein Haus erfolgte, bei dem seine Ehefrau und seine gerade erst geborene Tochter nur mit viel Glück mit dem Leben davon gekommen waren, rief King weiter dazu auf keine Gewalt anzuwenden und die weißen Brüder und Schwestern und selbst die Rassisten den Ku Klux Klans zu lieben.
Genau hierin lag vielleicht einer der entscheidenden Fehler Kings, der ihm ab Mitte der 60er Jahre zunehmend Unterstützung kosten würde. Während des Busboykotts von Montgomery auf einen friedlichen Verlauf der Aktionen zu achten war schon deshalb geboten, weil ansonsten der Einsatz der von Rassisten durchsetzten Nationalgarde drohte.
Doch es ist eben etwas anderes, ob man aus taktischen oder prinzipiellen Erwägungen heraus agiert. Prinzipiell, auch in Notwehrsituationen, auf Gewalt zu verzichten, bedeutete Aktivist*innen dem Terror des Ku Klux Klans und anderer rassistischer Organisationen auszusetzen. Zudem malte es mitunter das Bild als könnten die Afroamerikaner*innen allein darüber entscheiden, ob es zur Anwendung von Gewalt kommen würde. Nur ging die Gewalt eben von der anderen Seite – von Polizei, Gerichten und Rassist*innen – aus.
Kennedy will Präsident werden
Auf die Strategie der Gewaltlosigkeit, die nach King zudem den Vorzug besaß die Gewalt weißer Rassist*innen und der staatlichen Behörden offenzulegen, setzte King auch in den Jahren 1959 und 1960. Ermutigt von dem Erfolg in Montgomery versuchten – vorrangig Studierende aller Hautfarben – die „Rassentrennung“ in Kaufhäusern und in Cafes und Restaurants zu bekämpfen. Sie setzten sich in Bars und Imbissstuben auf Plätze, die ausschließlich für Weiße vorgesehen waren. Ließ man sie nicht in die Läden hinein, organisierten sie Sitzstreiks an den Zugängen. Polizei prügelte auf sie ein. Weiße Frauen und Männer beschimpften sie, bewarfen sie mit Essensresten und schlugen nicht selten zu.
Die Studierenden hielten Schilder mit Zitaten von Martin Luther King in die Luft und verpflichteten sich zur Gewaltlosigkeit. King war sofort begeistert. Er reiste nach Atlanta und beteiligte sich an den Aktionen, was die mediale Aufmerksamkeit auf den Kampf der Studierenden lenkte. Während einer Aktion gegen die Kaufhauskette „Rich‘s“, die auch Restaurants unterhielt, wurden King und 80 weitere Aktivist*innen von der rassistisch aufgehetzten Polizei festgenommen.
Über Tage hinweg erfuhr Coretta nicht wo sich ihr Ehemann genau befand oder wie es ihm ginge. Zudem wurde Martin Luther King jeder Kontakt mit einem Anwalt verwehrt.
In diesen Tagen rief ein junger Senator bei den Kings an. Er stellte sich als John Fitzgerald Kennedy und Präsidentschaftskandidat der Demokraten vor und bot Coretta Hilfe an. Auf ihre Bitte, setzte er kraft seines Amtes durch, dass Martin Luther King mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen konnte.
Kennedys Einsatz für King war taktisch motiviert: Bei den Wahlen stand ein knappes Ergebnis bevor. Wollte sich Kennedy als jugendlicher Reformer gegen den republikanischen Mitbewerber Richard Nixon durchsetzen, musste er zur Frage der Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung Stellung beziehen, was er damit tat. Nicht vergessen darf man auch, dass Martin Luther King mit der von ihm ins Leben gerufenen Organisation Southern Christian Leadership Conference (SCLC) gegen die „Großvätergesetze in den Südstaaten kämpfte. Die Eintragung hunderttausender Schwarzer in die Wähler*innenverzeichnisse stand bevor. Sie würden womöglich die Wahlen entscheiden.
Die Freilassung Kings zu erwirken blieb jedoch Sache der Aktivist*innen und Anwälte um ihn herum. Dennoch sollte sich der Telefonanruf Kennedys für ihn auszahlen: Gerade 100.000 Stimmen lag Kennedy in 1961 vor Nixon. Nicht weniger als 85 Prozent der Afroamerikaner*innen, die inzwischen wählen durften, gaben ihre Stimme dem jungen, demokratischen Kandidaten.
Kein verlässlicher Bündnispartner
Während die Bewegung sich nun auch auf die Überlandbusse ausweitete und auch dort die Abschaffung der Trennung nach Hautfarbe forderte, tat die Kennedy-Administration so gut wie nichts, um den „Freedom Riders“, die durch die Vereinigten Staaten fuhren zu helfen. Ebenso nahm das Weiße Haus kaum Anteil an der Sit-in-Bewegung, die weiterhin gegen ausschließlich für weiße bestimmte Kinos und Restaurants zu Felde zog. Insgesamt beteiligten sich 70.000 Menschen – Schwarze und zunehmend auch Weiße – an diesen Auseinandersetzungen. Nicht weniger als dreieinhalbtausend wurden verhaftet. Beteiligte Studierende wurden nicht selten von ihren Unis verwiesen, 38 Professoren wurden aus Amt und Würden gehoben, weil sie Teil der Proteste waren.
Als Martin Luther King in Albany gegen die „Rassentrennung“ demonstrierte, und Justizminister Robert Kennedy, den Bruder des Präsidenten, telefonisch um Hilfe bat, forderte der von King einen Abbruch der Demonstrationen in der Stadt – und King willigte ein! Der Kampf der Schwarzen um ihre Rechte hatte längst begonnen die Grundfeste der US-Gesellschaft infrage zu stellen. An einer derartigen Zuspitzung hatte die Kennedy-Administration kein Interesse.
Martin Luther King verließ die Stadt. Für den Rest seines Lebens würde er sich darüber immer wieder schwere Vorwürfe machen. Es war der vielleicht schwerste Fehler Kings auf die Einflüsterer der Kennedy-Regierung zu hören. Nie wieder würde er diesen Fehler begehen!
Brimingham, Alabama
Einer der vielleicht schwersten Kämpfe der Bürgerrechtsbewegung fand in Brimingham statt. Die Industriestadt war strikt segregiert und die Stadtherren erklärten in Reden immer wieder, dass sich daran nichts ändern würde. Der Polizeichef Eugene „Bull“ Connor war bekennender Rassist und stand mit dem Ku Klux Klan in Verbindung. Schon vor Beginn der Kampagne des SCLC in dieser Stadt erklärte er, dass er mit unmissverständlicher Härte vorgehen werde.
Doch auch King und der SCLC wollten es auf eine Auseinandersetzung ankommen lassen. Hatte der den Busboykott noch als „Noncooperation“, als „Nicht-Zusammenarbeit“, bezeichnet; gab er der Kampagne in Birmingham den Namen: „Project C“ – „Project Confrontation“!
Wochenlang demonstrierten die Aktivist*innen um King durch die Stadt. „Bull“ Connor griff jede Demonstration an. Er hatte die Wasserwerfer derart hart einstellen lassen, dass sie die Rinde von den Bäumen kratzte. Tausende wurden festgenommen. „Bull“ Connor wies die Polizei der Stadt sogar an Schüler*innen festzunehmen. Selbst Kinder im Alter von 8 Jahren wurden verhaftet. Anfang Mai 1963 reichten die Hafträume in Birmingham nicht mehr aus, weil allein 2.500 Kinder und Jugendliche im Gefängnis saßen.
Nun traten die Unternehmer der Stadt an King heran, um mit ihm ein Abkommen zur Aufhebung der „Rassentrennung“ zu vereinbaren. Der wochenlange Kampf hatte ihre Einnahmen empfindlich geschmälert. King verstand mehr als genug vom kapitalistischen System als dass er wusste, dass deren Druck auf die Stadtspitze ausreichen würde, um die Segregation dort für immer zu beenden und so ging er auf das Angebot ein.
Und dennoch verweigerte King die Unterschrift. Er hatte den Angehörigen der Inhaftierten und den Eltern der Kinder zugesichert, er werde Birmingham erst verlassen, wenn deren Schicksal geklärt wäre. Seine Berater redeten auf King ein, sie beschworen ihn zu unterzeichnen. King wies das entschieden von sich. Und wieder schaltete sich die Kennedy-Administration ein. Robert Kennedy wollte endlich Ruhe im Süden. Die Regierung fürchtete die Unterstützung weißer, rassistischer Abgeordneter in Kongress und Senat zu verlieren, wenn sie King nicht stoppte. Doch der blieb stur und unbeirrbar. Er würde den Fehler von Albany nicht wiederholen.
King entschloss sich zu einem Schritt, der viele beinahe schockierte. Er bat den örtlichen AFL-CIO, den Dachverband der Gewerkschaften, um Hilfe. Der war zwar vorrangig weiß geprägt. Doch jedes fünfte Mitglied war afroamerikanischer Abstammung. Damit waren Schwarze in den Reihen des AFL-CIO im Vergleich zur US-Bevölkerung, deutlich überrepräsentiert. Der wochenlange Kampf war am örtlichen AFL-CIO nicht spurlos vorübergegangen, seine bürokratische Führung geriet unter Druck und drohte mit Arbeitskampfmaßnahmen, sollte Kings Forderung nicht nachgegeben werden. Allein das reichte aus, Unternehmer und Stadt willigten ein.
Der Sieg war teuer erkauft. Noch Monate später verübten Rassist*innen unter dem Jubel des Ku Klux Klan Angriffe auf Schwarze und Weiße, die die Bürgerrechtsbewegung unterstützt hatten. Als sich gerade der Mädchenchor der Sixteenth Avenue Baptist Church für den Gesang in der Kirche umzog, explodierte dort eine Bombe, die vier kleine Kinder in den Tod riss und 21 verletzte. Die Predigt trug den Namen „eine Liebe, die vergibt“. Die beiden ermittelten Täter wurde wegen Besitzes von Sprengstoff und nicht wegen Mordes verurteilt. So erhielten sie eine sechsmonatige Haftstrafe und hatten 100 Dollar Strafe zu zahlen. Es wäre eine stets unzureichende Aufzählung des Schreckens, wollte man versuchen alle derartigen Vorfälle aufzulisten. Und dennoch war der Sieg gegen den institutionalisierten Rassismus, gegen Staat und Ku Klux Klan nicht mehr auszulöschen!
„Ich habe einen Traum“
Wenige Monate nach dem Ende des Kampfes in Birmingham riefen Martin Luther King und der SCLC ihre Anhänger*innen zur Demonstration in Washington auf. Der „Marsch für Arbeit und Freiheit“ sollte die an dem Tag im Repräsentantenhaus stattfindende Abstimmung über ein Gesetzeswerk zur Verbesserung der rechtlichen und sozialen Stellung der Schwarzen in den USA begleiten. Nicht weniger als 250.000 Menschen folgten dem Ruf. In der Nacht hatten Rassist*innen einen Anschlag auf die Anlage, über die King sprechen sollte, verübt und die Kabel zerschnitten. Ohne Kings Wissen bat sein Beraterkreis um Hilfe bei der Kennedy-Administration. Diese kommandierte eine Nachrichteneinheit der US-Armee herbei, die die Kabel zusammenflickte. Und dennoch lehnte Martin Luther King es ab, dass ein Vertreter der Regierung auf der Kundgebung reden dürfte. Dort formulierte er jenen unvergesslichen Satz, nach dem er hoffe, dass seine Kinder einmal nach ihrem Charakter und nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt würden. Und erklärte, dass man nicht eher ruhen werde, bis jede Form der Benachteiligung der afroamerikanischen Bevölkerung Geschichte wäre und dass man solange weiterkämpfe, wie auch nur ein Schwarzer Opfer von Polizeigewalt werden würde.
Der Tag war ein schwer zu überbietender Erfolg für das Ansehen der gesamten Bewegung, obwohl King und der SCLC den Kampf in Birmingham als wesentlich bedeutender einschätzten. Hiernach verdunkelten sich die Wolken über der Bewegung deutlich. Kennedy wurde im November Opfer eines Mordanschlages und sein Nachfolger Johnson war vollauf damit beschäftigt den imperialistischen Krieg in Vietnam zu führen.
Kriegsgegner
Spätestens ab 1964 verstand sich King als Gegner der US-Außenpolitik. Für ihn war der Krieg in Vietnam ein großes Verbrechen. Doch seine Berater*innen, ja selbst sein Vater warnten ihn immer wieder sich öffentlich als Kriegsgegner zu erkennen zu geben. Wollten Schwarze etwas erreichen, müssten sie US-amerikanische Patriot*innen sein. Zudem fürchteten viele, man würde die letzte Unterstützung der US-Regierung verlieren.
Doch King beugte sich dem Druck nicht. Immer wieder erklärte er offen seine Gegnerschaft zum Krieg in Fernost. Bis heute ist seine diesbezügliche Predigt aus dem Jahr 1967 an Deutlichkeit schwer zu überbieten: „Vielleicht wisst Ihr es nicht, meine Freunde, aber es wird geschätzt, dass wir 500.000 Dollar aufwenden, um einen feindlichen Soldaten zu töten, während wir gleichzeitig nur 53 Dollar für jeden Menschen ausgeben, der in unserem Land als arm eingestuft ist. […] Und deshalb bin ich immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass dieser Krieg ein Feind der Armen ist, und deshalb greife ich ihn an.“ Der rücksichtslose Terror gegen die vietnamesische Bevölkerung war für King, lange bevor das Massaker von My Lai die US-Bevölkerung aufrüttelte, ein unverzeichliches Verbrechen. Ein Verbrechen noch dazu, welches der US-Gesellschaft den Spiegel vorhalte. Man könne weiße und schwarze Soldaten auf den Fernsehbildschirmen sehen „wie sie zusammen töten und sterben für ein Land, das zu Hause nicht in der Lage ist, sie im gleichen Schulzimmer lernen zu lassen. Wir sehen ihnen zu, wie sie in brutaler Solidarität in einem armen Dorf die Hütten niederbrennen, aber wir wissen, dass sie in Chicago oder Atlanta wohl kaum im selben Quartier wohnen würden. Ich kann nicht schweigen angesichts einer solch brutalen Manipulation der Armen.“
Selbst jene Teile der bürgerlichen Presse, die ihn gerade wegen seines kompromisslosen Gewaltverzichts gelobt hatte, gossen nun kübelweise Unrat über Martin Luther King aus. Sie sprachen ihm schlichtweg die Befähigung ab, über solche Themen sprechen zu können. Dass sie damit in rassistische Deutungsmuster vom „naiven und unwissenden Schwarzen“ verfielen, schien ihnen schlichtweg egal zu sein.
Doch King war bei Weitem schlagfertig genug, um sich entschieden zur Wehr zu setzen: „Sie applaudierten uns bei unseren Freiheitsfahrten, als wir ohne Vergeltung die Schläge hinnahmen. Sie lobten uns in Alabama und in Birmingham und in Selma. Oh, die Presse war so nobel in ihrem Applaus für uns und so nobel in ihrem Lob, als ich sagte: ‚Wendet keine Gewalt an gegen Bull Connor‘ und als ich sagte; ‚Wendet keine Gewalt an gegen den rassistischen Sheriff Jim Clark.‘ […]. Das ist doch seltsam widersprüchlich an diesem Land und seiner Presse, dass sie dich loben, wenn du sagst: ‚Seid gewaltlos gegen Jim Clark‘, aber dich verdammen und verfluchen, wenn man sagt: ‚Tu kleinen braunen vietnamesischen Kindern keine Gewalt an.‘ Mit so einer Presse stimmt etwas nicht.“
Gegen Kapitalismus
Was auch die Berater*innen Kings mehr und mehr erschütterte, war seine immer stärkere Bereitschaft die soziale Frage mit den Kämpfen gegen Rassismus zu verknüpfen. Als King Ende der 50er Jahre mit Coretta durch Indien reiste, sah er erschrocken all die Armut. Gandhi hatte das Kastenwesen nie angegriffen. Dass es arm und reich gab, war für Gandhi nie wichtig gewesen. Für Martin Luther King sehr wohl. Schon während des Studiums hatte er Briefe an seine spätere Ehefrau geschrieben, in denen er erklärte, er sehe sich ökonomisch eher als Sozialist, denn als Kapitalist.
Nun, Mitte der 60er Jahre, waren genau diese Ansichten immer wieder Thema im Vorstand des SCLC. „Ein Haus, das Menschen zu Bettlern macht, muss umgebaut werden“, hatte King stets wiederholt. Nun gesellten sich Sätze hinzu wie: „Etwas stimmt nicht mit dem kapitalistischen System!“
In seinem 1966 erschienen Buch „wohin führt unser Weg“ plädierte er mit Nachdruck für ein Zusammengehen der US-Bürgerrechtsbewegung mit der klassischen Arbeiter*innenbewegung. Am Arbeitsplatz könne Rassismus besser als an vielen anderen Stellen bekämpft werden, weil dort das Interesse an möglichst großer Stärke gegenüber dem Unternehmer schwarze und weiße Arbeiter*innen quasi automatisch zusammenführen müsse. Und irgendwann in jenen Monaten fiel im Vorstand der SCLC auch der Satz: „Vielleicht müssen sich die USA in Richtung eines demokratischen Sozialismus entwickeln.“
Er formulierte es als Frage, aber es war mehr als das. Es war eine Kampfansage gegen ein System, in dem er immer mehr einen Kreisel aus Rassismus – Armut – Krieg zu erkennen glaubte. Demonstrationen für bessere Wohnbedingungen und die Forderung nach staatlichem Wohnungsbau waren die logische Folge dieser Ansichten.
Als King einen seiner (weißen) Berater um Rückkehr bat, der zurückgetreten war, weil das FBI seine Kontakte zu marxistischen Gruppen an die Öffentlichkeit gebracht hatte, war für Hoover, den Chef des FBI alles klar: King war Kommunist. Er musste Kommunist sein, also musste er weg. Mit gefälschten erpresserischen Briefen versuchte man ihn in den Selbstmord zu treiben, man platzierte Provokateure in seiner unmittelbaren Nähe, die seine gewaltlosen Proteste eskalieren lassen sollten.
Memphis
Es half nichts! Martin Luther King kämpfte weiter. Für den Sommer plante er die gewaltigste Massendemonstration in der Geschichte der USA. Seine „Poor Peoples Campaign“ stellte die Forderung auf, die Hilfe für Arme in den USA von jährlich 2 auf 30 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Dazu sollte nicht nur demonstriert werden. Ringsum das Weiße Haus plante King ein riesiges Protestcamp. Sollte Präsident Johnson dann nicht einknicken, würde man die Ministerien belagern und an ihrer Arbeit hindern. Und wenn das noch nicht reichen sollte, würde man ausgewählte Industriebetriebe mittels gewaltiger Proteste stilllegen. Und was das vielleicht Bedeutendste daran war, es sollte ein Kampf für alle US-Amerikaner*innen werden. Nur wenn man die Armut aller Menschen abschaffen werde, werde es auch keinen Rassismus geben. So Kings feste Überzeugung.
Beginnen sollte die Kampagne im Memphis. Dort streikten die fast ausschließlich schwarzen Müllarbeiter der Stadt schon seit Wochen. Das FBI schleuste Agenten in die Reihen der Protestierenden, die die Demonstrationen gewalttätig ausarten ließen. King ließ sich nicht beirren. Er werde nicht aufgeben. Notfalls müsse man eben den Streik auf alle afroamerikanischen Arbeiter*innen der Stadt ausweiten.
Am Vortag einer weiteren gewaltigen Demonstration durch Mephis, am 04.04.1968, wurde King erschossen. Den zwei Monate später verhafteten Täter, den entflohenen Sträfling James Earl Ray, hält die Familie Martin Luther Kings bis heute für ein Bauernopfer und glaubt an eine Tatbeteiligung des FBI.