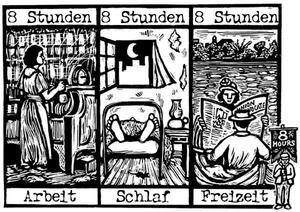Zehn Tage, die die Charité erschütterten
Sa 04.07.2015
Niemand, der diesen Streik mitbekommen hat, wurde nicht davon berührt. Zehn Tage lang streikten Hunderte Beschäftigte an der Charité für eine tarifvertragliche Regelung für mehr Personal im Krankenhaus, bis am 1. Juli ein Eckpunktepapier zwischen Gewerkschaft und Vorstand erreicht wurde. Historisch betrachtet ist dies der erste Streik im Krankenhaus, der nicht für mehr Lohn, sondern für mehr Personal geführt wurde – im Interesse von Beschäftigten und PatientInnen.
„Seit gestreikt wird, werde ich besser gepflegt“, sagte ein 72-jähriger Patient der BZ Berlin mitten im Arbeitskampf. Das macht deutlich, wie sehr Kolleginnen und Kollegen bemüht waren, eine gute Notfallversorgung während des Streiks zu gewährleisten. Das Motto des Streiks ‘Nicht der Streik, sondern der Normalbetrieb gefährdet die Patienten’ traf den Nerv vieler Berlinerinnen und Berliner.1200 Betten wurden gesperrt, über 20 Stationen dicht gemacht, der Arbeitgeber an den Rand der Verzweiflung gebracht. Den Kolleginnen und Kollegen ist im Laufe des Streiks bewusst geworden, dass dies ein politischer Kampf ist: Gegen die Politik einer Regierung, die mit dem neuen Krankenhausstrukturgesetz eine weitere Milliarde Euro in deutschen Krankenhäusern einsparen will, während laut Ver.di 162.000 Beschäftigte in deutschen Krankenhäusern fehlen. Und dass sie Pioniere sind und möglicherweise Geschichte schreiben. Es ist dem Kampfeswillen und der Entschlossenheit der KollegInnen und einer kämpferischen Ver.di-Betriebsgruppe zu verdanken, dass mit der Vereinbarung eines Eckpunktepapiers ein erster Erfolg errungen werden konnte.
von Lucy Redler, aktiv im Bündnis Berlinerinnen und Berliner für mehr Personal im Krankenhaus und SAV-Bundessprecherin
Am 1. Juli beschlossen Streikversammlungen demokratisch an allen drei Campussen der Charité, dass Ver.di Charité auf Grundlage des vorliegenden Eckpunktepapiers mit dem Arbeitgeber einen Tarifvertrag aushandeln soll und der Streik ausgesetzt wird. In den anstehenden Verhandlungen sind noch offene Fragen zu klären.
Carsten Becker, Vorsitzender der Betriebsgruppe an der Charité kommentierte dies am selben Tag wie folgt: „Nach 10 Tagen Streik geht es jetzt in die Verhandlungen zu unserem Tarifvertrag. Ein Tarifvertrag mit Quoten für Intensivpflege höchstens 1:2!, Intensivüberwachung höchstens 1:3!. Eine Quote für die stationäre Pflege konnten wir nicht erreichen (nur in der Kinderkrankenpflege 1:6,5). Aber dort, wie in den Funktionsbereichen, Psychiatrie, Radiologie und Kreißsaal entwickeln wir Mindeststandards, die erstens zu mehr Personal führen, zweitens bei drohender Unterschreitung zu Konsequenzen bis hin zum Bettensperren führen und drittens, dass wir nicht mehr allein im Nachtdienst sind.
Dann noch einiges zu Gesundheitsschutz und Förderung, mit Elementen der kollektiven Eigenbeteiligung. Uff! Das alles verhandeln und schreiben wir in den nächsten Wochen, zum Glück mit über 100 TarifberaterInnen! Wenn es nicht klappt, streiken wir wieder und wenn es klappt, dann haben wir damit auch gleich ein kleines Stück Geschichte geschrieben. Mehr von uns ist besser für alle!”
Signal: Geht doch!
Die Ausgangsforderungen von Ver.di Charité waren: Eine Quote für die Betreuung auf Intensivpflegestationen zwischen Pflegekraft und Patient von 1:2, in der stationären Pflege von 1:5 und Verbesserungen in allen nicht-pflegerischen Bereichen. Außerdem sollte kein Nachtdienst mehr allein verrichtet und das Recht auf Leistungseinschränkung tarifvertraglich fixiert werden.
Während Ver.di bundesweit darauf setzt, eine Personalbemessung gesetzlich durchzusetzen, hatVer.di Charité mit dem Streik etwas bewiesen, was lange auch in der eigenen Gewerkschaftumstritten war: dass ein Streik für eine tarifvertragliche Regelung möglich ist. Lange musste die Betriebsgruppe darum ringen. Zum einen mit dem Arbeitgeber, der zweimal versuchte den Streikmittels einstweiliger Verfügung gerichtlich zu untersagen und jedesmal scheiterte. Zum anderen mit der eigenen Gewerkschaftsführung, die erst nach starken Druck von unten grünes Licht für den Arbeitskampf gab.
Das Zwischenergebnis ist nun auch ein wichtiges Signal an KollegInnen anderer Krankenhäuser, jetzt nachzuziehen und ebenfalls den Kampf aufzunehmen. Ein solcher Kampf würde nicht nur die eigene Gewerkschaft herausfordern, sondern vor allem die Gesundheitspolitik der Bundesregierung erschüttern, die mit den Fallpauschalen auf ein budgetbasiertes Finanzierungsmodell setzt.
Wenn es zu einem Tarifvertrag an der Charité kommt, ist dies ein wichtiger tarifpolitischer Durchbruch. Zum ersten Mal in einem deutschen Krankenhaus werden dann im Intensivpflegebereich Quoten von 1:2 als Standard definiert (auch während der Nachtschicht) und Sondertatbestände festgelegt sowie eine Quote in der Kinderklinik eingeführt. Zudem werden weitere Stationen, die bisher der stationären Pflege zugeteilt waren, den Intensivpflegestationen zugerechnet. Ersten Informationen zufolge könnte es auf dieser Grundlage zu einer bundeseinheitlichen gesetzlichen Regelung für den Intensivpflegebereich kommen.
Der Arbeitgeber sperrte sich jedoch gegen eine Quotenregelung für die stationäre Pflege und die Funktionsbereiche. Es ist stark davon auszugehen, dass es hier Druck von politischer Seite gab, keine solche Regelung zu treffen, um eine Nachahmung in anderen Krankenhäusern zu verhindern. Um auch in diesem Bereich Quoten durchzusetzen wäre ein ganz anderer gesellschaftlicher Druck – auch durch Ver.di bundesweit – und Streiks in mehreren Krankenhäusern nötig gewesen.
Ein erstes Angebot nach vier Streiktagen, das lediglich zu Verbesserung im Intensivpflegebereich geführt hätte, wurde von den TarifberaterInnen zu Recht mit dem Argument zurück gewiesen, man wolle sich nicht spalten lassen.
Verbesserungen in der stationären Pflege
Nach weiteren drei Tagen Streik musste der Arbeitgeber auch ein Angebot für die stationäre Pflege auf den Tisch legen. Hier werden jetzt Mindeststandards als Haltelinien definiert und keiner soll mehr Nachtdienst allein verrichten. Auf Grundlage der in den neunziger Jahren angewandten Pflegepersonalregelung (PPR), die nach ihrer Abschaffung in manchen Kliniken noch als interner Berechnungsmaßstab verwendet wird, soll der errechnete Personalbedarf zu 90 Prozent PPR plus Nachtdienste und plus Sondertatbestände (besondere Tätigkeiten die zu erhöhter Belastung führen) erfüllt werden. Vor dem Streik hat der Arbeitgeber den Bedarf bei 85 Prozent PPR angesetzt und Nachtdienste und Sondertatbestände nicht beachtet. Oftmals wurde die 85 Prozent-Grenze sogar unterschritten. Dies ist jetzt nicht mehr möglich. KollegInnen jeder Station können nach Abschluss des Tarifvertrags selbst nachprüfen, wie viele Vollkräfte ihnen ungefähr zustehen. Der Anspruch für KollegInnen unterschiedlicher Stationen wird jetzt berechnet. Eine geplante Regelung zu Sondertatbeständen soll der Gewerkschaft und KollegInnen ein neues Instrument an die Hand geben, mehr Personalbedarf geltend zu machen und Sondertatbestände zu definieren wie zum Beispiel die Pflege von Demenzkranken.
Mit einer festen Untergrenze wird „der heimliche Stellenabbau an der Charité endlich gestoppt“, wie eine Kollegin unter Applaus sagte. „Alles in allem wird hier ein Systemwechsel von der budgetorientierten zur patientenorientierten Personalausstattung eingeführt,“ erklärt der Intensivpfleger Arthur Radvilas.
Entlastung schaffen
Wird die Vereinbarung nicht eingehalten, beispielsweise weil der Arbeitgeber nicht genug Personal bereit stellt, haben KollegInnen künftig über ihre Stations/Schichtleitungen das Recht, sich an einen Gesundheitsausschuss zu wenden und ihre Belastung anzuzeigen. In einer Eskalationskaskade wird dann Personal aufgestockt, die Arbeitsleistung eingeschränkt oder in letzter Konsequenz Betten gesperrt. Dies ist eine wichtige Regelung, um zu verhindern, dass im Falle fehlender Gelder zur Finanzierung oder unzureichender BewerberInnen, die Beschäftigten am Ende die Last tragen müssen. Unmittelbar sollen zudem alle befristeten Arbeitsverträge entfristet werden. Diese Regelungen sind auch deshalb sehr wichtig, weil davon auszugehen ist, dass es – im Falle einesfertigen Tarifvertrags – etwas dauern wird, bis eine Entlastung real spürbar wird.
In den Funktionsbereichen wie beispielsweise OP und Kreißsaal sollen Empfehlungen von Fachgesellschaften für die zukünftige Personalausstattung gelten. Jana Rauscheid von der Streikleitung des Virchow-Klinikums berichtet über einen Erfolg der KollegInnen der Radiologie: „Dass der Streik alle Beschäftigten betrifft und auch von den meisten mitgetragen wurde, zeigt sich darin, dass KollegInnen aus der Radiologie nach zehn Tagen solidarischem Mitstreiken feststellten, dass eben auch für sie eine personelle Verbesserung mit dem Abschluss des Tarifvertrags einhergeht.“
Kommt es zu einem solchen Tarifvertrag, soll dieser eine Mindestlaufzeit bis Ende 2016 haben.
„Waffenstillstand“
Um mögliche Fallstricke in den Verhandlungen mit dem Arbeitgeber über einen Tarifvertrag, den es bisher nicht gab, zu vermeiden, ist eine intensive Rückkopplung mit den TarifberaterInnen nötig.
Sollte durch den Arbeitgeber während der Tarifverhandlungen gegen das Eckpunktepapier verstoßen werden, kann die Gewerkschaft die Verhandlungen abbrechen und den Streik erneut hochfahren. Ein Kollege formulierte den Zustand so: „Oder symbolisch gesagt, die Pistole steckt im Holster aber die Hand liegt noch an ihr.“ Oder mit den Worten Stephan Gummerts von der Streikleitung: „Streik ist ausgesetzt. Es beginnt nach dem Etappensieg nun die nächste Phase des Konflikts. Militärisch gesprochen befinden wir uns im Waffenstillstand.“
Solidarität
Ein Streik in einem Krankenhaus ist nicht zu vergleichen mit anderen Streiks. Krankenhausbeschäftigte arbeiten am Menschen und retten im Zweifelsfall Leben. Beschäftigte stehen unter enormen, auch seelischen Druck, weil sie sich ihren PatientInnen gegenüber verantwortlich fühlen. Deshalb mussten viele KollegInnen, die gern mit gestreikt hätten, Notdienste verrichten, um PatientInnen nicht zu gefähren. Jeden Tag kämpften KollegInnen auf Stationen dagegen, dass gesperrte Betten durch den Arbeitgeber neu belegt wurden.
Ver.di Charité sorgte gemeinsam mit dem Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus dafür, PatientInnen und Angehörige zu informieren. Bei einer bewegenden Pressekonferenz des Bündnisses und Ver.di Charité am 1. Juli brachten PatientInnen zum Ausdruck, dass sie hinter dem Streik stehen. Die Patientenbeauftragte des Landes Berlins Karin Stötzner sagte deutlich: „Ich unterstütze den Streik aus tiefstem Herzen.“ Sie habe von keinem Patienten gehört, der sich durch den Streik gefährdet gesehen hätte. In einer nicht-repräsentativen Umfrage des Berliner Kuriers nach dem ersten Streiktag, unterstützten 99 Prozent der BerlinerInnen den Streik.
Dieser Streik war nicht nur ein offensiver, sondern auch ein aktiver Streik, der in die Kieze getragen wurde. Tausende Solidaritätsplakate wurden in der Stadt geklebt und verteilt, mit Flashmobs das Anliegen des Streiks in die Kieze getragen, bei Demonstrationen auf das Versagen der Regierungaufmerksam gemacht. Am elften Streiktag – nach der Unterzeichnung des Eckpunktepapiers – demonstrierten Hunderte Charité-Beschäftigte noch gemeinsam mit streikenden PostkollegInnen gegen die Bundesregierung. Solidaritätserklärungen kamen aus vielen Ländern, von Beschäftigten anderer Krankenhäuser und sogar vom Marburger Bund Berlin-Brandenburg, der Berliner Ärztekammer und der GDL. Max Uthoff von ‘Die Anstalt’ sprach den KollegInnen am fünften Streiktag Mut zu, hart zu bleiben.
Bei allen Demonstrationen sichtbar war auch die Unterstützung der KollegInnen der CFM. Bei der Charité-Tochter gibt es immer noch einen tariflosen Zustand und die KollegInnen bereiten sich auf eine Wiederaufnahme der Auseinandersetzung vor und haben dann unser alle Solidarität verdient.
Streikdemokratie
Der Streik war auch deshalb besonders, weil weitgehende Ansätze von Streikdemokratie vor, während und nach dem Streik praktiziert wurden. Diese waren auf den Campussen unterschiedlich stark ausgeprägt.
Wie bereits im Streik an der Charité und CFM 2011 gab es auch diesmal regelmäßige Streikversammlungen, bei denen diskutiert werden konnte und Entscheidungen getroffen wurden. Zusätzlich wurde ein System von TarifberaterInnen (Streikdelegierte) etabliert. KollegInnen jeder Station entsandten VertreterInnen in Treffen aller TarifberaterInnen, um Verhandlungsstände zu diskutieren, zu bewerten und in ihre Teams rückzukoppeln. Während des Streiks gab es tägliche Treffen dieser Struktur an zwei von drei Campussen und stadtweite Zusammenkünfte, bei denen die Verhandlungskommission über den Verhandlungsstand informierte und Rede und Antwort stehen musste. Bei campusübergreifenden Tarifberatertreffen beteiligten sich oft bis zu 100 TarifberaterInnen. Sie haben viele wichtige Diskussionen auch mit den KollegInnen geführt, die aufgrund von Notdiensten nicht mitstreiken konnten.
Die Entscheidung über die Annahme des Eckpunktepapiers und Aussetzung des Streiks wurde dann demokratisch von den Streikversammlungen entschieden.
Auch jetzt, bei der Erarbeitung des Tarifvertrags, soll es eine enge Rückkopplung und Diskussion mit den TarifberaterInnen geben, um Fehler zu vermeiden und die Expertise vieler KollegInnen einzubeziehen. Klar ist jedoch auch, dass dieses System an den unterschiedlichen Campussen unterschiedlich stark entwickelt ist und die Einbeziehung noch gesteigert und Abläufe weiter verbessert werden können. Einige KollegInnen, vor allem am Campus Benjamin Franklin in Steglitz, hätten sich gewünscht bei den Streikversammlungen noch detaillierter zu diskutieren, was das Ergebnis für ihre Station bedeutet. Dafür wäre möglicherweise noch mehr Zeit hilfreich gewesen. Das muss jetzt nachgearbeitet werden.
Politisierung
Beeindruckend ist das politische Niveau, auf dem während des Streiks diskutiert wurde. Das hängt erstens mit den Streikerfahrungen der Streikleitung und der Belegschaft aus den Streiks 2006 und 2011 zusammen. Zweitens haben sich KollegInnen bei den Tarifberatertreffen und Streikversammlungen selbst stark eingebracht, weil sie gespürt haben, dass dies ihr Streik ist. Drittens wurden im Rahmen einer ‘Streikuni’ – organisiert durch das Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus – politische Bildungsveranstaltungen organisiert. Die Autorin dieser Zeilen referierte beispielsweise an zwei Campussen über politische Streiks in Deutschland. Daraus entstanden lebendige Diskussionen von jeweils fünfzig bis siebzig Streikenden darüber, was den Streik an der Charité so politisch macht, wie die Gewerkschaften wieder zu Kampforganisationen werden können und warum es in Deutschland so lange keinen Generalstreik mehr gab. Andere Themen umfassten praktische Fragen zum Aufbau der eigenen Gewerkschaft. Dorit Hollasky aus Dresden berichtete in einem gemeinsamen Workshop mit Nadja Rakowitz von dem erfolgreichen Kampf gegen die Privatisierung der Dresdner Kliniken.
Der Streik hat nicht nur vieles in Bewegung gebracht, sondern die Streikenden selbst enorm bewegt. So meinte ein Ostberliner Intensivpfleger des Campus Mitte, dass er zum ersten Mal seit der Wende das Gefühl habe, er könne was bewegen.
Wäre mehr drin gewesen?
Stephan Gummert erklärte während des Streiks zu Recht: „Die Forderung nach mehr Personal ist systemimmanent innerhalb der herrschenden Budgetlogik der Fallpauschalen nicht zu realisieren. Sie rührt an der Systemgrenze der Krankenhausfinanzierung und damit an der Markt- und Verwertungslogik, die uns der Kapitalismus ja auch im Gesundheitsbereich organisiert.“
Während des Streiks wurde klar, dass der Streik – wenn er auf die Charité begrenzt bleibt – das Kräfteverhältnis nicht so weit verschieben kann, dass die Forderungen voll durchgesetzt werden.
Ver.di Charité, das Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus und einzelne Gruppen wie die SAV haben sehr viel unternommen, Öffentlichkeit zu schaffen und den politischen Druck zu erhöhen.
Es wäre ein qualitativer Unterschied gewesen, wenn Ver.di bundesweit ihre Strategie geändert hätte und auf einen Kampf für eine tarifliche Regelung auch in anderen Krankenhäusern gesetzt hätte undVer.di-Betriebsgruppen in vier oder fünf anderen Krankenhäusern ebenfalls den Kampf aufgenommen hätten.
Zudem hätte Ver.di bundesweit die Möglichkeit gehabt, Solidarität zu organisieren und dieVerbindung zu anderen Belegschaften herzustellen, die in Auseinandersetzungen stehen. Mehr als eine Unterschriftenliste, die auf der Ver.di-Website schwer zu finden ist, gab es jedoch nicht.
Viele KollegInnen fanden es sehr gut, dass es am letzten Streiktag nach der Unterzeichnung des Eckpunktepapiers eine gemeinsame Demo mit den streikenden PostkollegInnen gab. Das wurde durch beide Betriebsgruppen von unten vereinbart. Doch warum gab es keine gemeinsamen Demos von Beschäftigten von Amazon, Sozial und Erziehungsdiensten, Post, Bahn, Staatsballett, Charité und weiteren KollegInnen in Berlin und bundesweit? Es würde doch auf der Hand liegen, gerade wenn die öffentlichen Arbeitgeber in vielen Bereichen eine harte Haltung zeigen, KollegInnen zusammen zu bringen. Während einige Gewerkschaftssekretäre vor Ort diese Idee gut finden, unternimmt die Ver.di-Führung nichts, um einen solchen Prozess zu organisieren.
Mit solchen gemeinsamen Protesten, einer kämpferischen Kampagne zur Abschaffung der Fallpauschalen und für eine tariflich erkämpfte Personalbemessung hätte sowohl der Druck auf den Arbeitgeber an der Charité und auch auf die Regierung für eine gesetzliche Regelung qualitativgesteigert werden können. Vor dem Hintergrund, dass dies ausblieb, ist es mehr als beachtlich, was in einem Krankenhaus durchgesetzt werden konnte.
Solch eine kämpferische Gewerkschaftspolitik ist bundesweit nötig. KollegInnen, die sich für einen solchen Kurs einsetzen wollen, sollten sich vernetzen, auf Fachbereichsebene sowie übergreifend. So können Forderungen und Kampfvorschläge gemeinsam diskutiert werden, und kann der Druck für eine solche Gewerkschaftspolitik gemeinsam aufgebaut werden.
Die LINKE ist die einzige Partei im deutschen Bundestag, die sich solidarisch mit dem Streik erklärthat. Das ist enorm wichtig. SAV-Mitglieder sind in der LINKEn aktiv und setzen sich für einen kämpferischen und sozialistischen Kurs ein. Sowohl der Bundesparteitag im Juni als auch die Bundestagsfraktion zeigten sich solidarisch mit den Streikenden. Bei den Streikenden kam es sehr positiv an, dass die Fraktion während der ersten Demo der Beschäftigten Plakate zur Unterstützung des Streiks aus ihren Büros hängen ließen und den Streikenden zujubelten. Parteivorstandsmitglieder nahmen auch an der Demo teil. Doch insgesamt blieb die Partei mit 60.000 Mitgliedern weit unter ihren Möglichkeiten, den Kampf bekannt zu machen und Unterstützung zu organisieren, zum Beispiel durch Erstellung von Info-Flugblättern und massenhafter Verteilung vor Krankenhäusern bundesweit.Sie hätte viel stärker zum Faktor in der Auseinandersetzung werden können, ohne den Streik zu dominieren oder zu instrumentalisieren.
SAV aktiv im Streik
Mitglieder der SAV waren sowohl als Teil der Streikleitung als auch als UnterstützerInnen täglich im Streik aktiv. Gemeinsam mit anderen im Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus haben wir einen Beitrag geleistet, die Streikleitungen zu unterstützen, PatientInnen zu informieren, den Streik in die Kieze zu tragen, eine Solidaritätsveranstaltung von 200 Menschen – darunter GewerkschafterInnen aus anderen Betrieben – vor dem Streik auf die Beine zu stellen, Veranstaltungen im Rahmen der Streikuni und Solidaritätserklärungen bundesweit und international zu organisieren.
Mitglieder der SAV innerhalb und außerhalb der Charité waren bereits in den Streiks 2006 und 2011 aktiv, haben die Tarifbewegung für mehr Personal seit 2012 eng begleitet und haben wichtige politische Erfahrungen aus diesen Streiks an der Charité und der CFM gesammelt, die in diesem Streik sehr nützlich waren. Für viele unserer GenossInnen war die Unterstützung und Mitarbeit im Streik extrem spannend und wir möchten uns bei den KollegInnen für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Wir freuen uns darüber, dass sich einige überlegen, in der SAV aktiv zu werden oder diese Entscheidung bereits getroffen haben.
Was bleibt
Viele KollegInnen wissen, dass dies erst der Anfang war. 455 KollegInnen sind seit März neu in die Gewerkschaft eingetreten. Es kommt jetzt darauf an, die Betriebsgruppe weiter aufzubauen, den Tarifvertrag in Absprache mit TarifberaterInnen fertig zu stellen und wachsam zu sein, ob der Arbeitgeber sich an Vereinbarungen hält. Die Belegschaft der Charité geht aus diesem Streik politisch gestärkt mit vielen Erfahrungen hervor.
Eine Kinderkrankenschwester brachte das auf den Punkt: „Ich war nie politisch aktiv, aber diese Streikwoche war für mich teilweise sehr emotional. Also dieses Zusammenstehen und für etwas stehen, das hat mir ein ums andere Mal auch Gänsehaut bereitet. Und ich hab das Gefühl, ich bin in den Streiktagen zwei Zentimeter gewachsen. Es macht ein unheimlich gutes Gefühl. Ich bin nie ein Nein-Sager gewesen, aber so aufzustehen, wie ich es jetzt gerade mache und den Mund aufzumachen, ist für mich persönlich ein neues Gefühl, aber es erfüllt mich einfach mit Stolz – Für mich, für mein Team, für die Charité, für die Gewerkschaft.“