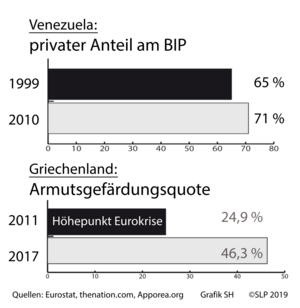VORWÄRTS-Schwerpunkt: Für eine Internationale Sozialistische Alternative zum Chaos des Kapitalismus!
Di 30.07.2024
Am Wochenende des 24.-26. Mai 2024 trafen sich Mitglieder der ISA aus ganz Österreich sowie internationale Gäste auf unserer Bundeskonferenz, um die aktuelle politische Lage zu analysieren und daraus Aufgaben abzuleiten. Die Konferenz fand in vielerlei Hinsicht gleichzeitig an einem Wendepunkt in der politischen Situation und auch für unsere Organisation statt. Das brutale Massaker des israelischen Regimes in Gaza mit Unterstützung des westlichen Imperialismus unterstreicht die Dringlichkeit eines Systemwandels. In der Nacht nach dem Ende der Konferenz verbrannten nach einem israelischen Militärschlag auf in Zelten untergebrachte Geflüchtete mehr als 40 Menschen. Die Brutalität dieses genozidalen Krieges zeigt den ganzen Horror des Kapitalismus in der “Periode der Unordnung". Aber gleichzeitig ist die internationale Bewegung gegen das Massaker in Gaza ein Leuchtturm der Hoffnung. Beides ist Ausdrucks einen Systems in tiefer Krise und der Suche von Arbeiter*innen, Jugendlichen und Unterdrückten nach einer Antwort.
Diese Suche nach Antworten drückt sich in Österreich auch darin aus, dass in einer Umfrage 63% der Befragten “Sozialismus” als ein sehr oder eher positives Wirtschafts- und Gesellschaftssystem angeben, sowie in den Wahlerfolgen der KPÖ. Proteste und Streiks wachsen - wenn auch noch immer auf niedrigem Niveau - doch gleichzeitig ist die FPÖ die stärkste Kraft bei den Wahlen.
Das zeigt die vielfachen Herausforderungen und Fragen für revolutionäre Sozialist*innen in der aktuellen Krise des Kapitalismus. Wie nutzen und entwickeln wir marxistische Theorie, um politische Entwicklungen wie den Rechtsruck tatsächlich zu verstehen? Wie verändert sich der Klassenkampf und die Entwicklung von Klassenbewusstsein im Vergleich zu früher und welche Rolle spielt der Kampf gegen Unterdrückung (Sexismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit) dabei? Welche Rolle können revolutionäre Sozialist*innen im Aufbau von Bewegungen spielen? Viele dieser Fragen und Diskussionen haben wir in unserer Organisation in den letzten Jahren teilweise auch sehr kontrovers geführt, was leider unter anderem auch zum Austritt der ehemaligen Bundessprecherin Sonja Grusch geführt hat, die diese Veränderungen nicht mitgehen wollte. Mit der Bundeskonferenz 2024 ist es gelungen, eine gemeinsame Analyse der politischen Situation und der damit verbundenen Aufgabe von revolutionären Sozialist*innen zu entwickeln, die wir in diesem Schwerpunkt darstellen wollen.
Revolutionärer Sozialismus in einer neuen Periode
In unserem Dokument zur politischen Lage in Österreich umreißen wir die Situation des globalen Kapitalismus wie folgt: “...Mehrere neue Krisen prägen die Lebensrealitäten der Arbeiter*innenklasse und der Jugend - allein seit 2020 wurde die internationale Arbeiter*innenklasse mit einer historischen globalen Pandemie, dem brutalen russischen Einmarsch in die Ukraine, der den größten militärischen Konflikt auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg markiert, und dem historischen Massaker in Gaza unter Führung der israelischen Kriegsmaschine konfrontiert. Verschiedene Elemente der kapitalistischen Krise, Krieg und ein sich beschleunigender imperialistischer Machtkampf, die Klimakrise, die rapide zunehmende Ungleichheit und Armut - sind miteinander verknüpft, beschleunigen und verschärfen sich gegenseitig. Während das kapitalistische System dem Untergang entgegenzugehen scheint, ist das Vakuum eines entschlossenen revolutionären Klassenkampfes, der in der Lage wäre, dieses zerfallende System durch eine sozialistische Alternative zu ersetzen, besonders groß.”
Vielfache Krisen
Während in den Jahren unmittelbar nach dem Fall des Stalinismus österreichische Konzerne durch die Ausbeutung Osteuropas und des Balkans fette Extraprofite einfahren konnten, stellt jetzt die zunehmende imperialistische Konkurrenz die exportorientierte österreichische Wirtschaft vor immer größere Probleme. Die wirtschaftlichen Verwerfungen, etwa durch den Ukraine-Krieg, haben z.B. mit der Rekordteuerung auch in Österreich massive Auswirkungen auf die Arbeiter*innenklasse. Gleichzeitig führt Krieg und Ausbeutung - angetrieben durch imperialistische Kräfte - dazu, dass immer mehr Menschen nach Österreich fliehen müssen. Auch die Klimakrise treibt Flucht weiter an, während die zunehmenden wirtschaftlichen Probleme und imperialistische Konkurrenz dazu führen, dass die Regierenden mehr Geld in Konzernhilfe und Aufrüstung stecken und bei den ohnehin begrenzten Klimaschutzmaßnahmen zurückrudern. Ähnliches gilt für den Care-Bereich (Gesundheits-, Bildungs- und Sozialbereich), der durch Unterfinanzierung in eine immer tiefere Krise rutscht.
Wir sehen, dass die vielen verschiedenen Krisen des Kapitalismus sich gegenseitig beeinflussen und verschärfen. Sie erzeugen das Gefühl eines allgemeinen Verfalls der Gesellschaft. Auf politischer Ebene führt das zu einer weit verbreiteten Ablehnung des politischen Establishments - die aktuelle Koalition ist die unbeliebteste in der 2. Republik. Aber diese Krisen sind auch die Grundlage für den Rechtsruck: in der kapitalistischen Krise sind die Herrschenden immer stärker auf autoritäre und rechte Ideen angewiesen und gleichzeitig profitieren Rechtspopulist*innen, indem sie Migrant*innen, queere Personen und Arme zu Sündenböcken machen und der krisengebeutelten Realität eine gute alte Zeit gegenüberstellen. Deshalb ist es so zentral, die Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Krisen ins Zentrum zu rücken und der reaktionären Schein-Alternative der Rechten eine internationale sozialistische Perspektive entgegenzustellen.
Klassenbewusstsein und Klassenkampf
Die vielfältigen Krisen des Systems führen auch in Österreich zu einer Zunahme von Bewegungen - unter anderem Streiks in Branchen vom Metallbereich über die Freizeitpädagogik bis zu den Brauereien. Gleichzeitig entwickelt sich international - und vor allem in Österreich - dieser Widerstand vor dem Hintergrund einer jahrelangen neoliberalen Offensive und einem enorm verwirrten Bewusstsein. Gerade die österreichische Gewerkschaftsbürokratie hat jahrzehntelang die Arbeiter*innenklasse zur Passivität erzogen und versucht, Streiks zu verhindern. Auch diese mangelnde Erfahrung mit Widerstand stärkt den Rechtsruck. Wenn Menschen keine Erfahrungen damit haben, wie sie durch gemeinsame Selbstorganisierung, Proteste und Streiks Veränderungen erreichen können, dann stärkt das die Kräfte, die nach unten statt nach oben treten.
Genau deshalb ist eine zentrale Aufgabe von Sozialist*innen der Aufbau und die Stärkung von Selbstorganisierung und Widerstand. Wir können hier eine enorm wichtige Rolle dabei spielen, Wut in Widerstand und greifbare Erfolge zu verwandeln. Dafür ist es entscheidend, dort anzusetzen, Menschen schon beginnen, sich zu wehren und weitergehende Schlüsse ziehen. Erfolgreiche Kämpfe - wie die Abwehr des Angriffes auf die Freizeitpädagogik durch Proteste und Streiks - können dann eine Vorbildwirkung für andere Arbeitskämpfe und die Gewerkschaftsbewegung bzw. Widerstand allgemein haben. In Österreich legen wir als ISA deshalb z.B. einen Schwerpunkt auf den Aufbau von Organisierung im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich und auf den feministischen und antirassistischen Widerstand.
Kampf gegen spezifische Unterdrückung
Ein weiteres zentrales Element der aktuellen Periode ist die Bedeutung von Unterdrückung (Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit usw.) und dem Kampf gegen sie im Klassenkampf, also dem Kampf zwischen der Arbeiter*innenklasse und armen Bevölkerung einerseits und den wirtschaftlich und politisch Herrschenden andererseits. Diese setzen auf rechte Hetze gegen einzelne Gruppen. Viele Bewegungen und Kämpfe entzünden sich genau hieran. Das geht von “Black Lives Matter”, über die wachsenden Demos am internationalen feministischen Kampftag (8. März), die “Frau, Leben, Freiheit”-Bewegung und die Gaza-Solidaritätsproteste bis hin zu den Arbeitskämpfen u. a. im Care-Bereich oder bei den Fahrradbot*innen.
Es ist kein Zufall, dass so viele Bewegungen sich gerade in weiblichen und migrantisierten Teilen der Arbeiter*innenklasse abspielen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Zusammensetzung der Erwerbstätigen massiv geändert: In Österreich hat sich die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt von 1970 bis 2022 von 30% auf 73% erhöht. Bzgl. Menschen mit Migrationshintergrund von 191.011 (1975) auf 1.203.300 (2022). Gerade diese Schichten der Arbeiter*innenklasse wurden in schlecht bezahlte Jobs gedrängt (Handel, Care-Bereich, Hilfsarbeiter*innen), um den Bossen noch größere Extra-Profite zu sichern und das System am Laufen zu halten. Die Pandemie hat gezeigt, wie essentiell viele dieser Berufsgruppen für unsere Gesellschaft sind. Aber gleichzeitig leiden diese Schichten der Arbeiter*innenklasse auch am stärksten unter wirtschaftlichen Krisen und den ganz realen Auswirkungen des politischen Rechtsrucks auf ihr Leben und werden von den Gewerkschaften oft nicht angemessen vertreten.
Etablierte “linke” Kräfte - wie die SPÖ unter Babler - reagieren auf die rechte Hetze, indem sie selber nach rechts gehen. Die KPÖ wählt als bewusste Taktik, weniger über Rassismus zu reden und mit sozialen Themen zu überzeugen. Aber genau damit überlässt man einerseits den Rechten das Feld und öffnet andererseits die Tür für noch härtere Angriffe auf die Leben unterdrückter Teile der Arbeiter*innenklasse. Die Antwort von revolutionären Sozialist*innen muss das Gegenteil sein: erkennen, dass der Kampf gegen jede Unterdrückung ein zentraler Teil des Klassenkampfes ist und dass die Mobilisierung der Klasse gegen jeden rechten Angriff entscheidend ist, um den Rechtsruck zurückzudrängen und eine Bewegung aufzubauen, die eine tatsächliche Alternative darstellen kann.
Der Kapitalismus verändert sich - führt zu neuen Krisen, Katastrophen, aber auch Widerstand und Bewegungen. Um darauf eine Antwort zu geben, muss sich auch unsere marxistische Analyse und Praxis entsprechend weiterentwickeln.
Marx aktuell: Die Revolutionäre Partei
Die Notwendigkeit einer sozialistischen Systemalternative ist so groß wie schon lange nicht mehr. Aber wie organisieren wir uns, um dafür zu kämpfen? Die Erfahrungen der Geschichte - z.B. die Niederlage der Allende-Regierung 1973 in Chile oder der Syriza-Regierung 2015 - zeigen, dass schrittweise, reformistische Veränderungen scheitern und wir stattdessen einen revolutionären Bruch mit dem System brauchen. Die Massenbewegungen der letzten Jahre von Chile über Frankreich bis zum Iran zeigen, dass Revolutionen möglich sind. Aber aus diesen Beispielen - und zahlreichen anderen in der Geschichte - sehen wir auch, dass eine Massenbewegung alleine nicht ausreicht. Um den Kapitalismus tatsächlich zu stürzen, braucht es eine Organisation, die im Moment der Revolution die unglaubliche Energie der Massen organisieren und kanalisieren kann, um eine erfolgreiche sozialistische Veränderung durchzusetzen - eine revolutionäre Partei.
So eine Organisation kann nicht erst zum Zeitpunkt einer revolutionären Bewegung und auch nicht isoliert von existierenden Kämpfen und Bewegungen aufgebaut werden. In den Kämpfen der Klasse allgemein ist es meistens so, dass Teile vorangehen - und auch bei Widerstand im Betrieb gibt es oft einige Kolleg*innen, die eine treibende Rolle spielen. Eine revolutionäre Partei versucht, solche Prozesse aufzugreifen und gleichzeitig Menschen, die weitergehende und sozialistische Schlußfolgerungen gezogen haben, zu organisieren. Marx und Engels schreiben dazu im kommunistischen Manifest: “Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer weitertreibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder; sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus.”
Gleichzeitig ist es notwendig, diese Organisierung rund um eine marxistische Methode und ein Programm aufzubauen. Gerade angesichts einer komplexen Vielfach-Krise des Kapitalismus und einem Mangel an Klassenkampf-Tradition und sozialistischen Ideen ist dieser bewusste Zugang besonders wichtig.
Bolschewismus geht auch anders
Die Veränderungen in der politischen Situation und die Weiterentwicklung unserer Analysen müssen sich auch in der Praxis von linken Organisationen ausdrücken. In den 1990ern und frühen 2000ern waren marxistische Kräfte gesellschaftlich isoliert, wenige Menschen glaubten an die Möglichkeit oder Notwendigkeit einer Systemveränderung. Klassenkämpfe und Bewegungen waren trotz Ausnahmen (wie der Massenbewegung gegen die erste ÖVP/FPÖ Bewegung) auf einem eher niedrigen Level. Viele linke Kräfte haben sich als Reaktion darauf von einer revolutionären sozialistischen Perspektive verabschiedet und sich auf kleinere Projekte konzentriert. Kräfte, die weiter an einer revolutionären Perspektive festgehalten haben, waren dazu gezwungen, “den Marxismus” gegen die neoliberale ideologische Offensive zu verteidigen.
Mit einer neuen Periode, wachsender Systemskepis, Klassenkämpfen und Offenheit für sozialistische Ideen ändert sich das. Es geht nicht mehr vor allem darum, einen Kern an Ideen zu "verteidigen", sondern eine marxistische Perspektive im Austausch mit dem existierenden Bewusstsein, aktuellen Bewegungen und Kämpfen weiterzuentwickeln sowie darum, eine wichtige Rolle in Bewegungen zu spielen und dazu beizutragen, die Arbeiter*innenbewegung und Organisierung wieder aufzubauen.
Bewegungen, Selbstorganisierung und Kämpfe aufbauen!
Obwohl wir eine kleine Organisation sind, können wir eine wichtige Rolle dabei spielen, Widerstand und Selbstorganisierung in einigen zentralen Bereichen zu unterstützen - wo Bewusstsein und Kämpfe schon am weitesten fortgeschritten sind. Wir wollen nicht nur eine Organisation aufbauen, die abstrakte Propaganda für eine sozialistische Veränderung macht, sondern eine Organisation, die durch ihr Programm und ihre Praxis einen Weg aufzeigt, wie wir von der heutigen Ausgangslage dorthin kommen können.
Deshalb unterstützen wir z.B. den Aufbau der Basisintiative “Wir sind sozial aber nicht blöd”, die schon jetzt eine wichtige Rolle dabei gespielt hat den privaten Gesundheits- und Sozialbereich zum wahrscheinlich kämpferischsten Sektor hierzulande zu machen. In diesem Prozess wurden auch eine Reihe an zentralen Fortschritten erzielt: die Etablierung von öffentlichen Streiks und Betriebsversammlung statt Streiks nur in Betrieben, die Popularisierung von Urabstimmungen über Verhandlungsergebnisse oder “wilde Streiks” (d.h. ohne Unterstützung der Gewerkschaftsführung) bzw. neue Formen der Streikdemokratie. Durch den Aufbau und die Unterstützung der sozialistischen-feministischen Initiative ROSA ist es gelungen, den ersten Schulstreik am 8. März gegen Sexismus und Krieg zu organisieren, außerdem die größten klar linken, internationalistischen und feministischen Proteste der “Frau, Leben, Freiheit”-Bewegung und zahlreiche wütende Kundgebungen gegen Femizide und transphobe Übergriffe in unseren Nachbar*innenschaften.
Interne Kultur und demokratischer Zentralismus
Die Veränderung unserer Analysen und Arbeit muss auch zu einer Veränderung der internen Parteikultur führen. In einer Periode der “Verteidigung des Marxismus” gibt es automatische Tendenzen in Richtung eines “Top-down”-Zugangs: Einer sehr bestimmenden Führung aus einzelnen Individuen und einer dadurch passiven Mitgliedschaft. So eine Kultur ist auf allen Ebenen unfähig, eine Kampforganisation aufzubauen. Es braucht eine bewusste Ausbildung, ein Lernen voneinander, die aktive Beteiligung und die vielfältigen Erfahrungen von Menschen, die an ihren Arbeitsplätzen, Schulen, Unis und Nachbarschaften aktiv sind. Das gilt auch für einen bewussten Umgang mit Machtverhältnissen und den internen Kampf gegen sexistische Sozialisierung und Co. Ansonsten wird gesellschaftliche Diskriminierung reproduziert und es wird unmöglich, eine echte sozialistisch-feministische Organisation aufzubauen.
Diese Veränderungen und Weiterentwicklung in den Analysen, der Praxis und der Kultur der Organisation sind kein leichter Prozess. Aber sie waren schon jetzt die Grundlage für die Entwicklung einer neuen Schicht an - vor allem jungen und weiblichen - neuen Mitgliedern, die schon jetzt die politische Arbeit der Organisation transformieren und uns dazu in die Lage versetzen werden, in den nächsten Jahren eine wachsende Rolle im Aufbau von Bewegungen, Klassenkämpfen und einer Sozialistischen Alternative zu spielen.